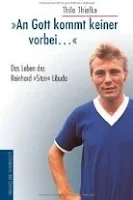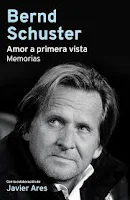Neulich sprach ich mit einem Verleger über den typischen Verkaufszyklus eines Fußballbuches - und insbesondere das Momentum einer Neuerscheinung. "Die ersten sechs Monate sind die entscheidenden", meinte er, "danach ist das Buch praktisch weg vom Fenster." Früher sei diese Zeitspanne noch doppelt so lang gewesen. Gemessen daran dürfte bei Klaus Dermutz' bereits vor zwölf Jahren erschienener Ernst-Happel-Biographie "Genie und Grantler" (Verlag Die Werkstatt) derzeit nicht mehr viel passieren. Was sehr schade ist, denn es ist ein zeitloses, heute wie damals höchst lesenswertes Buch über einen der ganz Großen der Branche.
Klaus Dermutz, kein Mann vom Fach, sondern einer des Theaters, zeichnet mit viel Sorgfalt alle Stationen des "Wödmastas" nach, die Zeiten als Spieler bei Rapid Wien und Racing Paris, die Trainerjahre in Holland und Belgien, natürlich die Ära als Coach des Hamburger SV und dann Ende der 80er Jahre die Heimkehr nach Österreich als Trainer des FC Swarovski Tirol und schließlich der Nationalmannschaft, ehe er den Kampf gegen den Krebs endgültig verlor.
Mich haben an diesem Buch gleich mehrere Aspekte fasziniert. Zum einen hat Dermutz, wenn ich es richtig sehe, mit seinem Sujet (nur) zwei etwa anderthalbstündige Interviews geführt, eines 1986 in Hamburg und eines 1991 in Innsbruck. Im Übrigen basiert das Buch auf Gesprächen mit Weggefährten und vor allem Archivmaterialien. Drei Stunden mögen viel für einen Mann wie Happel sein, der Pressekonferenzen auch schon mal nach 30 Sekunden beendete. Aber für eine über 300 Seiten dicke Biographie? Ich habe schon mit Autoren gesprochen, die mit ihren Protagonisten die zehnfache Zeit zugebracht haben. Gemessen daran kommt Dermutz der Person Happel beeindruckend nahe - nach der Lektüre hat man ein intimes und rundes Gesamtbild des Menschen, Spielers und Trainers.
Auch wenn Dermutz seinem Landsmann mit unverkennbarer Sympathie und Bewunderung begegnet, spart er - auch das keine kleine Leistung - dessen Schwächen nicht aus. Stellenweise ist die Lektüre sogar ausgeprochen schmerzhaft. Ex-Spieler wie Felix Magath, Horst Hrubesch oder Manfred Kaltz sprechen bis heute nämlich mit größter Hochachtung von ihrem Ex-Coach und weisen immer wieder auf seine enormen menschlichen Qualitäten hin. Doch in seinen letzten Trainerjahren in Österreich, so Dermutz, entwickelte sich Happel, bereits gezeichnet von der Krebserkrankung, zu einem Despoten, der mit grausamer Härte regierte. Erfolge des FC Tirol waren stets sein Verdienst, Niederlagen (wie das legendäre 1:9 im Europapokal der Landesmeister 1990/91 gegen Real Madrid) die Schuld der Mannschaft. Er hintertrieb die Berufung seines argentinischen Ballkünstlers Nestor Gorosito in die Nationalelf, indem er ihn, wenn deren Späher nach Innsbruck kamen, einfach nicht aufstellte - weil er ihn "ausschließlich für seinen Klub haben will und nicht bereit ist, ihn für die langen und anstrengenden Reisen abzustellen". Er legte sich mit Stars wie Hansi Müller und Bruno Pezzey an, die teilweise in die zweite Mannschaft verbannt wurden. Dermutz: "Die Spieler versuchen mit Galgenhumor ihrer Angst Herr zu werden. Sie sehen sich der reinen Willkür ausgesetzt und schließen Wetten ab, wen als nächsten Happels Bannstrahl treffen wird. Der Trainer wird für sie zu einem völlig unberechenbaren Autokraten." Ähnlich unsympathische Züge legte Happel auch im Privatleben an den Tag - gegenüber irgendwelchen Wirtshaus-Spezln zeigte er sich großzügig und beglich in aller Regel die gemeinsamen Rechnungen, für seine letzte Lebensgefährtin, die "die sein Leiden bis zum bitteren Ende miterlebte, nur mehr Helferin, Krankenschwester war, seine Launen, genährt von seiner unheilbaren Krankheit, hinunterschluckte, oft verzweifelt: ›Ich kann das alles nicht mehr ertragen‹, klagte, dennoch bis zum letzten Atemzug bei ihm war, seine Hand hielt, bis er einschlief, hatte er nichts übrig. (…) Veronika musste zurücktreten in die zweite, ja in die letzte Reihe. Sie durfte nicht einmal beim Begräbnis an seiner Bahre stehen."
Fasziniert hat mich das Buch auch deshalb, weil es vielleicht das große Erfolgsgeheimnis des österreichischen Welttrainers offenbart, der in vier Ländern Meistertitel feierte und zweimal den Europapokal der Landesmeister gewann. Happel, der ein einzigartiges Kauderwelsch aus Deutsch, Holländisch, Flämisch und Wienerisch sprach, keine unnötige Zeit mit Grammatik verschwendete ("Aber Sie wissen, heutzutage mit die Medien [...]") und mitunter zu ausgesprochenen Derbheiten neigte, gilt ja bis heute als der wortkarge Grantler, der keinen einzigen Satz zu viel sagte. Ich frage mich, ob er womöglich deshalb so erfolgreich war, weil er vorzugsweise den Mund hielt und im Übrigen häufig nicht verstanden wurde. So blieb unentdeckt, dass Ernst Happel, wenn er denn mal sprach, mitunter hanebüchenden Unsinn und fürchterliche Plattitüden von sich gab. Beispiele gefällig? Nur zu gern: So sagte er über die WM 1986 in Mexiko: "Ich habe nicht gerechnet mit Argentinien, ich habe nicht gerechnet mit Deutschland." Frage: "Mit wem haben Sie gerechnet?" Antwort: "Mit Deutschland muss man immer rechnen." Aha. Auf die Frage, welche Fähigkeiten ein Spitzentrainer mitbringen muss, führt Happel aus: "Wenn ein Fußballtrainer nie Fußball gespielt hat, kann er nie ein Trainer werden. Das ist der Grundvorsatz, dass er selbst aktiv war, auf einem bestimmten Niveau gespielt hat." Soso. Und was ist beispielsweise mit Arrigo Sacchi, der mit dem AC Mailand von Erfolg zu Erfolg eilte, während Happel auf der Bank des FC Tirol unter dem österreichischen Fußball litt? Frage: "Was bringt ein technisch versierter Spieler für eine Mannschaft?" Antwort: "Er muss natürlich alles bringen, er kann nicht technisch gut beschlagen sein und im Zweikampf schwach, da hat man nichts, aber es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn er technisch beschlagen ist [...]." Wer hätte gedacht, dass es im Fußball von Vorteil ist, wenn der zweikampfstarke Spieler auch noch technisch beschlagen ist?
Sehr gespannt war ich auf Dermutz' Ausführungen zu Wolfram Wuttke und Dieter Schatzschneider, die 1983 als hochgehandelte und ziemlich teure Nachfolger von Horst Hrubesch und Lars Bastrup
zum HSV kamen, dort jedoch Schiffbruch erlitten. Wieso gelang es einem
so begnadeten Trainer wie Happel nicht, diese beiden Spieler in die Spur
zu bekommen, insbesondere Wolfram Wuttke nicht, dessen an guten Tagen
schlicht geniale Art, Fußball zu spielen, ihn doch in Verzückung
versetzen musste? Dermutz widmet dem Thema durchaus Raum, in Interviews
mit Happel, mit Magath, in seinen Analysen, aber eine wirklich
befriedigende Antwort findet auch er nicht. Auch die lebenslange Fehde
Happels mit seinem einstigen Teamkollegen Max Merkel
wird im Buch immer mal wieder aufgenommen, hätte aber ob der
erstaunlichen Parallelen - beide Männer spielten bei Rapid, beide wurden
Trainer in Holland, beide errangen Meistertitel in Deutschland - gern
ausführlicher behandelt werden können. Aber das ist Geschmackssache.
Ebenfalls sicherlich Geschmackssache, aber in meinen Augen die einzige echte Schwäche der Biographie ist der Drang des Autors, wirklich alles zwischen die zwei Buchdeckel zu packen, was auf dem Tisch lag. Dermutz hatte mit Happel - wie gesagt - zwei längere Interviews geführt. Im Rahmen seiner Ausführungen zitiert er ausgiebig daraus, mitunter auch mehrfach, um dann jedoch die beiden Gespräche im Anhang noch einmal in voller Länge abzudrucken. Das mag einen gewissen sporthistorischen Wert haben, führt im Buch aber zu unschönen Redundanzen, was gerade bei den eher derben Passagen stört. Für meinen Geschmack lese ich etwas zu oft, dass Spieler ohne "Beistrich in der Unterhose" auftreten sollten oder ein Schiedsrichter, der Happel nicht genügend Respekt zollt, "kein kleines, sondern ein großes Arschloch" ist. Hier wäre weniger vielleicht mehr gewesen. Dies ändert indes rein gar nichts daran, dass "Genie und Grantler" ein großartiges Buch ist, welches eine echte Lücke gefüllt hat und das ich in meiner Bibliothek nicht missen möchte.
Klaus Dermutz: "Ernst Happel: Genie und Grantler", Verlag Die Werkstatt